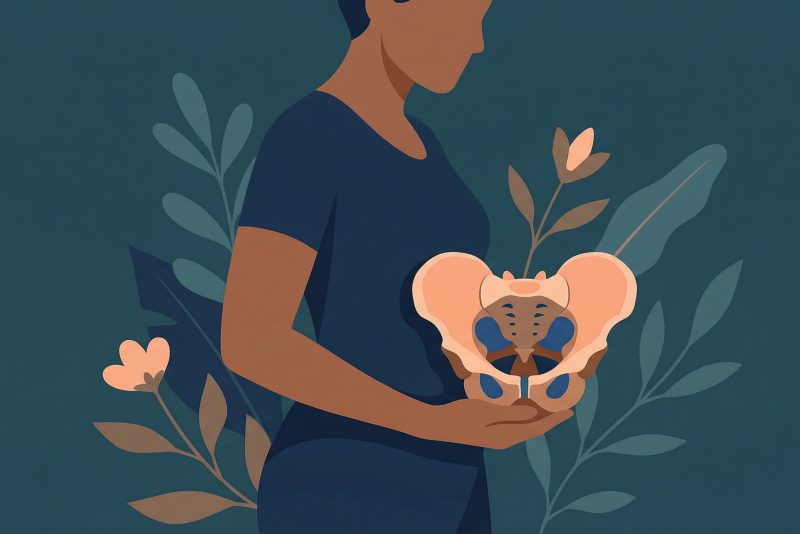Die weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) ist eine schwere Menschenrechtsverletzung mit gravierenden physischen und psychischen Folgen für betroffene Frauen und Mädchen. Trotz weltweiter Bemühungen um die Abschaffung dieser Praktik wird FGM/C weiterhin in vielen Ländern durchgeführt. Auch in Europa, einschliesslich der Schweiz, leben gefährdete oder bereits betroffene Mädchen. Die rechtliche Lage unterscheidet sich im globalen Kontext je nach Land deutlich. Eine Übersicht.
Schweiz: strafbar seit 2012
In der Schweiz ist weibliche Genitalbeschneidung ausdrücklich strafbar. Das Strafgesetzbuch stellt die Verstümmelung weiblicher Genitalien mit Artikel 124 seit 2012 unter Strafe – unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Einwilligung des Opfers erfolgt. Die Strafnorm beinhaltet auch die exterritoriale Strafbarkeit, was bedeutet, dass – sofern die Täterin oder der Täter sich in der Schweiz befindet – auch Eingriffe im Ausland mit bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug bestraft werden können. Die Schweiz setzt darüber hinaus auf Prävention. Verschiedene regionale Anlaufstellen, darunter auch FGMhelp im Kanton Zürich, setzen sich mit Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit für Sensibilisierung zum Thema FGM/C sowie für die Unterstützung von Betroffenen und Gefährdeten ein.
Deutschland: eigener Straftatbestand seit 2013
In Deutschland wurde das Strafrecht 2013 mit §226a StGB verschärft, um weibliche Genitalverstümmelung als eigenen Straftatbestand zu erfassen. Auch hier gilt die extraterritoriale Strafbarkeit. Die Tat kann demnach auch dann verfolgt werden, wenn sie im Ausland begangen wurde, sofern das Opfer in Deutschland lebt. Die Mindeststrafe beträgt ein Jahr, die Höchststrafe 15 Jahre Freiheitsstrafe. Das deutsche Gesetz unterscheidet sich von vielen anderen durch seine deutlich schärfere Strafandrohung und den breiten Anwendungsbereich. Zusätzlich gibt es seit 2015 eine bundesweite Koordinierungsstelle beim Bundesfamilienministerium sowie Schulungen für medizinisches Personal, Lehrerinnen und Lehrer sowie Jugendämter.
Österreich: nationale FGM-Strategie
In Österreich fällt FGM/C unter den Tatbestand der schweren Körperverletzung (§85 StGB), kann aber unter bestimmten Umständen auch als Verstümmelung weiblicher Genitalien nach §90 StGB geahndet werden. Das Strafmass reicht bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Seit 2013 gilt wie in Deutschland und der Schweiz auch in Österreich die extraterritoriale Strafbarkeit. Die Gesundheits- und Integrationsministerien arbeiten mit NGOs wie der Plattform StopFGM zusammen, um gezielt betroffene Communities zu erreichen und Präventionsarbeit zu leisten. Österreich hat zudem eine nationale FGM-Strategie entwickelt, die in das Gesamtfeld der Gewaltprävention eingebettet ist.
EU: Sensibilisierung und Schulungen
Die Europäische Union hat FGM/C mehrfach klar als Menschenrechtsverletzung verurteilt. In der Istanbul-Konvention des Europarats (2011) verpflichten sich unterzeichnende Staaten, gegen geschlechtsspezifische Gewalt – einschliesslich FGM/C – vorzugehen. Auch die EU-Kommission setzt auf Sensibilisierung, eine bessere Datenlage und Schulungen. Allerdings ist die Umsetzung unterschiedlich weit fortgeschritten. Während Länder wie Schweden, Frankreich oder Belgien strenge Gesetze haben, fehlt es in anderen Staaten noch an klaren rechtlichen Regelungen oder der entsprechenden Durchsetzung.
Weltweite Rechtslage: Kluft zwischen Gesetz und Praxis
Weibliche Genitalbeschneidung ist in über 40 Ländern gesetzlich verboten. Dazu gehören die meisten Staaten Afrikas sowie einige asiatische Länder. Dennoch bleibt die Kluft zwischen Gesetz und Praxis in vielen Ländern gross.
Afrika:
Diverse Länder wie Ägypten, Kenia, Nigeria oder Burkina Faso kennen spezifische FGM-Verbote. Die Durchsetzung dieser Gesetze bleibt dennoch oft schwach. Gründe dafür sind mangelnde Rechtsstaatlichkeit, sozio-kultureller Druck und unzureichende Aufklärung.
Asien:
In Ländern wie Indonesien, Malaysia oder Indien ist FGM/C weniger thematisiert. In gewissen Gemeinschaften wird weibliche Genitalbeschneidung teilweise durchgeführt, FGM/C wird aber nicht gesetzlich geregelt oder gar toleriert.
Amerika und Australien:
In den USA, Kanada sowie in Australien ist FGM/C verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Die Gesetzgebung ist dabei meist eng an die Einwanderungspolitik gekoppelt. Auch hier gilt oft extraterritoriale Strafbarkeit.
Fazit: umfassende gesellschaftliche Aufklärung und kulturelle Sensibilisierung bleiben zentral
Die rechtliche Ächtung weiblicher Genitalbeschneidung ist weltweit vorangeschritten, trotzdem bestehen weiterhin grosse Herausforderungen. Selbst dort, wo klare Gesetze existieren, bleibt die praktische Umsetzung schwierig – häufig aufgrund einer ausbleibenden konsequenten Strafverfolgung, mangelnder Präventionsarbeit oder fehlender kultureller Aufklärung. Um FGM/C weltweit zu beenden, braucht es nicht nur Gesetze, sondern umfassende gesellschaftliche Aufklärung, kulturelle Sensibilisierung und konkrete Unterstützung für betroffene und gefährdete Mädchen und Frauen.