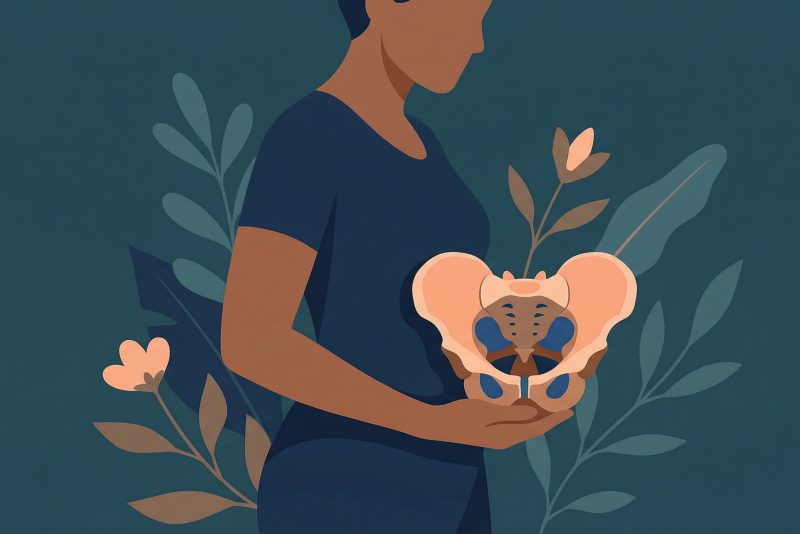Weibliche Genitalbeschneidung, international bekannt als FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting), betrifft weltweit viele Mädchen und Frauen. Laut UNICEF (2023) sind in Ländern wie Somalia, Guinea, Djibouti, Mali, Ägypten, Sudan, Eritrea und Sierra Leone zwischen 80 und 99 % der Frauen von FGM/C betroffen.
In vielen Ländern, in denen FGM/C praktiziert wird, stellt sie weit mehr als nur ein medizinisches Thema dar. Die weibliche Genitalbeschneidung ist eng mit kulturellem Selbstverständnis, Tradition, Religion und gesellschaftlichen Normen verknüpft. Die Praxis kann mit der Vorbereitung auf das Erwachsenenleben und auf die Ehe, mit Verschönerung und Anpassung an die kulturelle Norm sowie mit Jungfräulichkeit oder Treue in der Ehe verbunden sein.
In Bezug auf die Erkennung und den Umgang mit Traumafolgestörungen bei Frauen, die von weiblicher Genitalbeschneidung betroffen sind, ist eine differenzierte Betrachtung notwendig, denn nicht jede Frau, die von FGM/C betroffen ist, ist auf Grund dessen traumatisiert.
Das Zusammenspiel zwischen
- dem Ausmass an Belastung bei der FGM/C,
- dem Erleben von weiteren belastenden und/oder traumatischen Erfahrungen (z.B. Gewalterfahrungen, das Leben in Kriegsgebieten, Fluchterfahrungen),
- psychologischen Faktoren (z.B. Persönlichkeit, individuelle Bewältigungsstrategien),
- biologischen Voraussetzungen (z.B. Genetik, Stressreaktion)
- sowie dem sozialen Umfeld, soziokulturellen Rahmenbedingungen und sozialen Unterstützungsstrukturen oder deren Fehlen
ist für die Entwicklung einer Traumafolgestörung oder die Bewältigung eines belastenden und möglicherweise traumatischen Ereignisses, wie es die weibliche Genitalbeschneidung eines sein kann, ausschlaggebend.
Trauma und Traumafolgestörungen aus psychologischer Sicht
Der Begriff Trauma stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet «Wunde» oder «Verletzung». Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Trauma als ein kurz- oder langanhaltendes Ereignis von aussergewöhnlicher Bedrohung und katastrophalem Ausmass, das starke seelische Erschütterungen hervorruft. Typische Auslöser sind Bedrohungen des Lebens, schwere Verletzungen oder Formen physischer bzw. sexualisierter Gewalt.
Traumatische Erfahrungen gehen mit intensiven Gefühlen von Angst, Hilflosigkeit und Ohnmacht einher. Da übliche Bewältigungsstrategien in traumatischen Situationen nicht ausreichen, setzen biologische Überlebensmechanismen wie Kampf (Fight), Flucht (Flight) oder Erstarrung (Freeze) ein. Diese können Einfluss auf die Verarbeitung einer traumatischen Situation haben.
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychische Erkrankung, die als Folge von traumatischen Erfahrungen auftreten kann.
Folgende drei Hauptsymptome liegen bei einer PTBS vor:
- Wiedererleben (Flashbacks): Betroffene erleben das traumatische Ereignis wiederholt in der Gegenwart, z.B. in Albträumen oder als intensive Sinneswahrnehmungen.
- Übererregung: Erhöhte Wachsamkeit, Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit und anhaltendes Bedrohungsgefühl.
- Vermeidung: Situationen, Orte, Personen oder Gedanken, die an das Trauma erinnern, werden gemieden.
Als Begleitsymptome treten häufig Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gefühle von emotionaler Abstumpfung, Gereiztheit und chronische Schmerzen zusätzlich auf.
Gespräche mit Betroffenen bedürfen Achtsamkeit
Wichtig: Das Verständnis, die Wahrnehmung sowie der Ausdruck von psychischen Belastungen sind wie die Ausübung von FGM/C stark in die Kultur eingebettet und vom kulturellen Kontext einer Person geprägt. So kann es beispielsweise für eine Person sehr belastend und mit Stigma verbunden sein, über psychische Belastungen zu sprechen und folgend auf die Frage «Wie geht es ihnen?» mit «Gut» zu antworten, obwohl diese Person unter schweren Belastungen leidet.
Häufig kann der Einstieg zu einem Gespräch über traumatische Erfahrungen und/oder eine möglicherweise vorliegende PTBS über Fragen zu Schlafschwierigkeiten, zu körperlichen Symptomen wie starke Anspannung oder Schmerzen, zu veränderten Verhaltensweisen wie Vermeidung oder Vergesslichkeit oder zu «vor den Augen ablaufenden Bildern/Videos zu belastenden Erinnerungen» gefunden werden. Zudem kann die Verwendung von Metaphern eine weitere erleichternde Methode zur Besprechung von belastenden Erfahrungen sein.